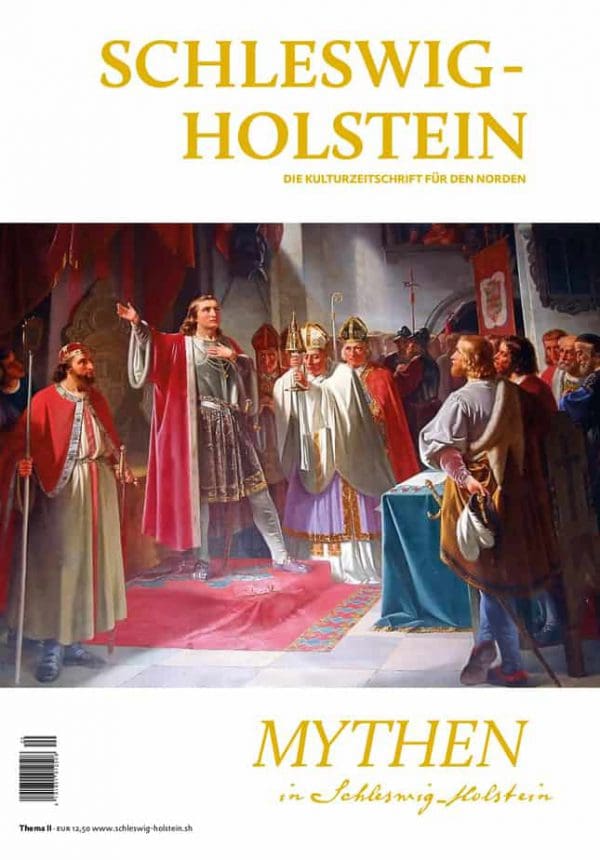„Habt Ihr den Amerikaner schon gesehen? Das fragten kürzlich die Leute in einem Dörfchen einander; denn es war Einer aus Amerika zurückgekommen. Der trug einen mächtigen roten Bart, einen grauen Hut, einen dunkelblau tuchenen Mantel, und er ließ die beiden Flügel weit in den Wind hinausfliegen, dass man das scharlachrote Futter sehen konnte, das unter dem Mantel und Kragen war.
Jetzt kann ich mir’s denken, warum die Leute auf der Gasse zusammenliefen, wenn der Amerikaner kam, und warum Klein und Groß in die Fenster fällt, wenn er durchs Dorf geht (…). Und wenn er erst anfängt zu erzählen: vom Lande der Freiheit jenseits des Meeres, von den großen Städten (…) von den breiten Flüssen (…) wenn er davon spricht, wie jegliche Arbeit reichen Lohn bringt, (…) – dann begreif ich’s, warum sie dem Amerikaner zuhören, als wär’s ein Evangelium, was er sagt. Sie meinen, drüben wäre das Paradies, das Land wo Milch und Honig fließen und wo der Himmel voller Geigen hängt!“
So steht es im Husumer Wochenblatt vom 24. Januar 1897 (Quelle: Bibliothek und Archiv des NordfrieslandMuseum NISSENHAUS), Husum. Und darum wird es nun gehen: um den Mythos des Aufstiegs vom Tellerwäscher zum Millionär, um das „Wunsch“-bild der USA als dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo Freiheit und Wohlstand dem Wagemutigen winken.

In dieses Bild hinein passen Lebensläufe wie der des geborenen Husumers Ludwig Nissen. Per Testament hinterließ er 1924 seiner Geburtsstadt ein Millionenvermögen mitsamt Kunstsammlung, um dort ein „Volkshaus“ mit Kunstgalerie, Vortragssaal und Bibliothek zu bauen: das heutige Nordfriesland Museum NISSENHAUS. 1855 in Husum geboren, 1872 mit 16 nach New York ausgewandert und 1924 in Brooklyn gestorben, hat er wie kein anderer Schleswig-Holsteiner den amerikanischen Traum, denn nichts Anderes ist der Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär, gelebt. Wobei die außergewöhnliche Leistung des späteren Diamantenimporteurs, des Pearl King des „Perlen-Königs“ New Yorks, wie er genannt wurde, nicht im Anhäufen von Dollars bestanden hat, sondern in seiner, wie wir heute sagen würden, fast beispiellosen Integrationsleistung, die ihm diesen Aufstieg erst ermöglichte. Ein Aufstieg in dreifacher Hinsicht: zuerst in die Welt des New Yorker Einwandererviertels Little Germany auf Manhattan, dann in die weiße, anglo-amerikanische, protestantisch-calvinistische Mittel- und Oberschicht Brooklyns und als letzter und schwierigster Schritt die Integration in den überaus konservativen Kreis der Kapital- und Wirtschaftselite, der Captains of Industry der Vereinigten Staaten.
Verbunden mit solchen „Aschenputtel-Karrieren“ vom armen Einwanderer zum reichen Magnaten ist im Herkunftsland die ebenso bekannte Geschichte vom „reichen Onkel aus Amerika“, der bis in die fünfziger und sechziger Jahre regemäßig auch in bundesdeutschen Filmen und auf Bühnen auftrat. Die de luxe-Version des Stifters und Mäzens finden wir bei Ludwig Nissen. So war ein Besucher aus den USA immer schon, wie wir im Eingangszitat aus dem Jahr 1847 gehört haben, zuerst einmal eine Attraktion, und zwar mit teilweise nachhaltiger Wirkung. Vor Jahren erzählte mir ein etwa 70-jähriger von Gästen aus Amerika, die seine Eltern in den 1950er Jahren besuchten. Besonders in Erinnerung geblieben war deren „Ami-Schlitten“ mit Weißwandreifen und mindestens 150 PS – für den Jungen von damals Besuch aus einer anderen Welt.
Aber der eingangs erwähnte Artikel aus dem Husumer Wochenblatt bietet im weiteren Verlauf noch eine andere Einschätzung, wenn es dort heißt:
„Der versteht das Windmachen (…) mit seinem grauen Hute und rotgefütterten Mantel [aber] hat am Ende sich Leute suchen müssen, die ihn wieder frei herüberbrachten – und das war Lumperei.“ Der Autor des Artikels stand dem Besucher ablehnend gegenüber und auch den meisten Berichten aus den USA gegenüber war er kritisch eingestellt. Denn weiter hieß es: „Und was die Briefe anbelangt, die (…) von Amerika herüberkommen (…) Ach, das Papier ist geduldig und die Schiffe bringen oft so schwere Fracht von Lügen mit herüber, wie sie Menschen und Güter hinüber getragen haben.“
Tatsächlich waren es zum Teil gerade die ersten Briefe nach der Ankunft, die voller Begeisterung für das Neue und Unbekannte auch die meisten Übertreibungen und Fehleinschätzungen enthielten. Aber fast immer wurde ein Schlüsselbegriff hervorgehoben: jenseits des Meeres gab es ein Land der Freiheit! Die Idee der Freiheit und der damit verbundene Mythos aber ist ein höchst ansteckender Traum. In Schleswig-Holstein sowie den deutschen Landen allgemein stand dieser Traum in hartem Gegensatz zu einer absolutistischen bis autokratischen Staatsmacht. Und so wurde von manchem Briefschreiber „Freiheit“ dann auch mit Abwesenheit von staatlicher Gewalt und drangsalierender Obrigkeit und Kirche gleichgesetzt, wenn es dann naiverweise so oder so ähnlich wie im schon erwähnten Zeitungsartikel hieß: „Es ist ein freies Leben in Amerika; es gibt keine Gerichte und keine Polizei; es kann Jeder treiben was er will. (…) Man braucht vor keinem Pfarrer und Schulmeister hier die Kappe abtun!“

Solche oberflächlichen Äußerungen konnten wie im Husumer Wochenblatt leicht auf schulmeisterliche Art herabgekanzelt und verspottet werden. Weit wirksamer war es, wenn sich Freiheit als demokratische Regierungsform definierte: als eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Eine Formel, die US Präsident Abraham Lincoln 1863 in seiner Gettysburg Address so prägnant zusammengefasst auf den Punkt brachte: „government of the people, by the people, for the people“. Und nur zur Information: eine gravierte Schmuckausgabe dieser Rede hing auch im Arbeitszimmer Ludwig Nissens in New York.
Es entstand so in Europa langsam ein Idealbild oder auch Wunschtraum der USA, die sich auch z.B. an einem Zitat von Theodor Mommsen aus dem Jahr 1901 festmachen lassen: „Wäre ich dreißig Jahre jünger, so ginge ich nach Amerika, wo doch bei allen seinen schweren Schäden die Hoffnung der Welt liegt.“ Aber nicht jeder hatte und hat die differenzierte Sichtweise des in Garding geborenen Berliner Althistorikers und Literaturnobelpreisträgers, und so kommt es bis heute immer wieder zu Enttäuschungen, wenn das Wunschbild, der „Mythos Amerika“ hart auf die Realität auftrifft. Aber dieses nur als Bemerkung nebenbei – zurück zu den Besuchern.
In der „alten Heimat“ an Land ging in der Regel ein amerikanischer Staatsbürger, d.h. ein freier Mensch und Niemandes Untertan mehr. Durchaus selbstbewusst und durch seinen US-amerikanischen Pass hinlänglich geschützt, waren diese Besucher den örtlichen Polizeibehörden oft ein Dorn im Auge, den Militärbehörden in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der 1867 eingeführten allgemeinen Militärpflicht sogar vielmals ein durchaus fühlbarer Stachel im Fleisch selbstgefälliger Allmacht. Grundsätzlich aber waren sie verdächtig, da sie vom Bazillus der Freiheit infiziert waren und darum mussten sie überwacht werden. Auf diese Weise entstanden z. B. in königlich preußischer Zeit die „Akten zur Überwachung von Auswanderern, die sich als US-Bürger wieder in Schleswig-Holstein aufhielten“. Dieses reichhaltige Material liegt im Landesarchiv in Schleswig und ist eine gute und ergiebige Quelle.
Mit dem Wunsch nach Freiheit verband sich die Aussicht auf Wohlstand, und es entstand dieser mächtige Magnet, der vor allem im 19. Jahrhundert Millionen Männer, Frauen und Kinder über den Atlantik zog. Wie ein kleiner Teil vom Ganzen verkörperte der Besucher die Wünsche und Hoffnungen der Daheimgebliebenen und sein Beispiel magnetisierte und elektrisierte Viele, mit denen er in Berührung kam. Daher war das Misstrauen der Behörden wohlbegründet, denn wie hieß es wieder im selben Artikel des Husumer Wochenblattes:
„Der Amerikaner ist ja auch einmal ein armer Schelm gewesen im deutschen Vaterlande (…) aber er hat Mut gehabt und ist nach Amerika gegangen, und jetzt ist er – ein gemachter Mann. Wie mag so einem armen Schelme, dem hier die Kreuzer (…) spärlich durch die rauhen Finger rutschen, das Herz im Leibe hüpfen, wenn er an die Dollars denkt, die ihm drüben schwer im Beutel liegen werden, und wenn er sich’s ausmalt in seinen Gedanken, wie er auch einen grauen Hut und einen blauen Mantel mit rote, Futter tragen kann, wie der Amerikaner.“
Versuche gegenzusteuern blieben demgegenüber wirkungslos. Behördliche Warnungen und Verlautbarungen wurden von der Bevölkerung grundsätzlich misstrauisch und ablehnend zur Kenntnis genommen. Als Informationsquelle dienten die von Hand zu Hand gehenden Briefe, die so und z. T. auch veröffentlicht eine erhebliche Breitenwirkung entfalteten. Der nun schon mehrfach erwähnte Bericht im Husumer Wochenblatt von 1847, dessen Autor einer Auswanderung eher ablehnend gegenüberstand, endete mit dem schönen poetischen Resümee: „Bleibet im Lande und nähret Euch redlich, Rückt zusammen und füget Euch ein.“ Aber was war dieser fromme, ja staatstragende Wunsch gegen die nur wenige Monate später (1848) wie ein Lauffeuer um den Globus rasende Nachricht, dass man am Sacramento Fluss Gold gefunden habe. Nein, dass dort in Kalifornien das Gold nur so herumliege – man brauche es nur noch aufzuheben! Hinzukam das Scheitern der Schleswig-Holsteinischen Erhebung gegen Dänemark und so begann in den 1850er Jahren die große Übersee-Auswanderung auch in Schleswig-Holstein.
Die USA wurden für immer mehr Menschen zum Land ihrer Träume. Negative Berichte fanden dagegen von Anfang an recht selten den Weg zurück in die Heimat. Einen Grund dafür gab schon das Husumer Wochenblatt 1847 an: „Es fällt mir so mancher ein, der’s auch nicht an die große Glocke hängt, was er in Amerika gefunden hat. Geht’s Einem gut, so rühmt er’s mit vollen Backen, geht’s aber schlecht, so schweigt er mäuschenstille (…) Es mag sich halt Keiner gerne auslachen lassen.“ Da wirkte schon eine gewisse Selbstzensur. Wer will es schon eingestehen, sich und anderen, dass er es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu nichts gebracht habe.
Fast entschuldigend klingt es denn auch in dem Brief „eines ausgewanderten Husumers an seine Eltern“, abgesandt in Michigan City und abgedruckt im Husumer Wochenblatt am 18. Oktober 1881: „Wenn es besser für Euch wäre, hierher zu kommen, warum sollte ich Euch davon abraten? Vater wird doch nicht glauben, dass sein eigenes Kind ihm etwas vorschwindeln will (…) Ich verdiene hier noch immer nicht mehr als 1 Dollar pro Tag. Vielleicht gehe ich zum Winter nach Texas, um Baumwolle zu pflücken.“ Apropos auslachen lassen: wenn er tatsächlich nach Texas gegangen sein sollte, werden die farbigen Pflücker dort vielleicht heute noch die Geschichte vom „crazy Dutchman“ erzählen, der mit Baumwolle pflücken reich werden wollte. Den Mythos gibt es nicht. Er wäre wohl doch besser Schuhputzer oder Tellerwäscher geworden. Ludwig Nissen war zur selben Zeit in New York und litt ebenso unter der schweren Wirtschaftskrise von 1873 bis 1879, aber während dieser Zeit legte er das Fundament für seinen steilen Aufstieg, den er im Juweliergewerbe mit Beginn des Wirtschaftsbooms ab 1880 begann. Der zitierte unbekannte Husumer „Baumwollpflücker“ ist sicher nicht als reicher Onkel nach Nordfriesland zurückgekehrt.
Aber es waren ohnehin nicht immer nette Onkels mit prallgefüllten Koffern voller Dollars, die aus Amerika zu Besuch kamen. Oh nein! Es gab auch ganz Andere, die so gar nicht dem gängigen Mythos entsprachen. Einer von diesen war Nanning Tönissen von Amrum. 1867 war er in die USA abgereist und später auch als amerikanischer Staatsbürger fast jedes Jahr auf die Insel zurückgekehrt, wo er auch zweimal geheiratet hatte – bis er 1888 endgültig ausgewiesen wurde. (Quelle: Auswanderer-Archiv Nordfriisk Instituut) Nanning sei, so schrieb der Landvogt 1888, ein außergewöhnlich großer und starker Mann gewesen. Wenn er betrunken war, und das war er viel zu oft, war er zudem nicht nur besonders rauflustig, sondern auch ziemlich schlagkräftig, so dass die Bewohner Amrums sich dann vor ihm fürchteten und versuchten ihm aus dem Wege zu gehen, was auf einer Insel nicht immer einfach ist. Ausgewiesen wurde er letztendlich auf Betreiben seines Schwiegervaters, weil er auch gegen seine Familie handgreiflich geworden war.
Nichts zu tun hatte dieser trinkfeste Friese mit dem „Manhattan“, der erst ab den 1950/60er Jahren auf den Inseln Föhr und Amrum „mythische Realität“ erlangte. Rückkehrer und Besucher brachten das New Yorker Modegetränk zurück in die Heimat und schon bald durfte es auf keiner Familienfeier mehr fehlen. Als fertigabgefüllter Mix gilt der „Manhattan“ heute als „Föhrer Spezialität“ bestehend zu gleichen Teilen aus Bourbon Whiskey, weißem und rotem Martini sowie wahlweise einer Cocktail-Kirsche.